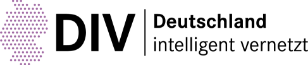Insgesamt zeigt sich, dass es bereits eine Vielzahl innovativer Ideen und Geschäftsmodelle für Intelligente Energienetze im Markt gibt, die jedoch zum Durchbruch klare staatliche Rahmenbedingungen beim Datenschutz, bei der Anreizregulierung und beim Rollout intelligenter Messsysteme benötigen. Liegen diese Rahmenbedingungen vor, wird im Markt ein Wettbewerb um die effizientesten Lösungen entfacht werden.
Intelligente Energienetze
Status und Fortschritt priorisierter Handlungsfelder
Im Rahmen des Stakeholder Peer Reviews wurden priorisierte Themen zu Intelligenten Energienetzen vertiefend betrachtet. Folgende Detailbeschreibungen und Bewertungen bilden diese Schwerpunktsetzung ab.
weitere Maßnahmen erforderlich
am Anfang
hohe Dringlichkeit
Der Rollout von intelligenten Stromzählern, sogenannten Smart Metern, bei größeren Verbrauchern und Einspeisern sowie an netzdienlichen Messpunkten ist ein wesentlicher Baustein für den Erfolg der Energiewende. Dies sah schon das 3. Richtlinienpaket zum Binnenmarkt für Energie aus Brüssel von 2009 vor. Deutschland hat 2011 entsprechend eine gesetzliche Einbauverpflichtung für Endkunden beschlossen (Verbrauch > 6.000 kWh/Jahr, Neubau/Renovierung, EEG/KWKG-Anlagen und gegebenenfalls weitere Fälle).
Die Umsetzung in Deutschland zieht sich allerdings wesentlich länger hin als gedacht. Nachdem das BMWi im Sommer 2013 eine Kosten-Nutzen-Analyse veröffentlicht hat, die zu dem Ergebnis gekommen ist, dass zumindest ein selektiver Rollout von Smart Metern in Deutschland für alle Beteiligten vorteilhaft ist, hat das BMWi erst im Frühjahr 2015 Eckpunkte für das Verordnungspaket Intelligente Energienetze mit Details zum Rollout von Smart Metern veröffentlicht. Parallel hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ein hochkomplexes Konzept für Datenschutz und Datensicherheit des Smart Meter Gateway ausgearbeitet.
Nun warten sowohl die IKT- als auch die Energiebranche auf die Fertigstellung des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende, das im Entwurf der Bundesregierung als wesentlichen Bestandteil ein neues Messstellenbetriebsgesetz enthält, damit endlich mit dem Rollout begonnen werden kann. Die rechtlichen Rahmenbedingungen müssen nun so schnell wie möglich finalisiert und verabschiedet werden.
Die Bundesnetzagentur (BNetzA) weist darauf hin, dass sich der Smart Meter Rollout um weitere zwei bis drei Jahre verzögern könnte, da man dort erst nach Vorliegen eines Kabinettsentwurfs mit der Überarbeitung der Marktkommunikation beginnen werde. Die BNetzA sollte jetzt zügig und ohne weitere Verzögerung gemeinsam mit allen Beteiligten die Marktkommunikation angemessen weiterentwickeln, sodass die Geräte schnellstmöglich betrieben werden können. In diesem Zusammenhang sollten die bewährten Kommunikationswege über die Verteilnetzbetreiber beibehalten und weiterentwickelt werden, da eine Übertragung auf die Transportnetzbetreiber eine weitgehende Überarbeitung der Marktkommunikation erfordern würde.
Die Verzögerungen in den letzten Jahren und die anhaltende Unsicherheit über den Rechtsrahmen haben zu einer besorgniserregenden Investitionszurückhaltung geführt. Dies hat einen Stillstand des Marktes in Deutschland zur Folge und gefährdet massiv die Position deutscher Unternehmen im internationalen Wettbewerb dieses Segments.
kritisch
fortgeschritten
hohe Dringlichkeit
Die Energiewende erfordert erhebliche Investitionen in intelligente Verteilnetze als Plattform für zukünftige Märkte. Die entsprechenden Eckpunkte des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie für eine Weiterentwicklung der Anreizregulierung sind jedoch nicht dazu geeignet, Investitionen der Verteilnetzbetreiber besser zu ermöglichen. Hier besteht erheblicher Korrekturbedarf.
Insbesondere beinhaltet der Übergang zu intelligenten Netzen erhebliche technische und regulatorische Risiken, die angemessen berücksichtigt werden müssen und im Fall des Risikoeintritts eventuell Sonderlösungen bedürfen.
Auch verschärft sich der Averch-Johnson-Effekt (zu hohe Kapitalintensität regulierter Unternehmen) in intelligenten Netzen, weil die erforderliche Substitution von Kapital- durch Betriebskosten gebremst wird. Hier müssen kurzfristig kompensierende Maßnahmen geprüft werden, etwa in Form spezieller Anreizmechanismen.
weitere Maßnahmen erforderlich
fortgeschritten
hohe Dringlichkeit
Seit der Liberalisierung haben sich die Struktur der Energiemärkte sowie die Marktprozesse stark gewandelt. Dieser Wandel, der auch zur Definition neuer Marktrollen führte, wird mit der Umsetzung der Energiewende und der Digitalisierung von Markt-, Steuerungs- und Kontrollprozessen weiter forciert.
Zur Übernahme und Integration von neuen Aufgaben z. B. im Rahmen des Flexibilitäts- und Speichermanagements ist zu prüfen, inwieweit bestehende Marktrollen mit neuen Aufgaben ausgestattet werden müssen oder ob es erforderlich ist, neue, zusätzliche Marktrollen (z. B. Aggregator) gesetzlich zu definieren.
Ebenso sind die Marktprozesse hinsichtlich ihrer Eignung und Effizienz zu überprüfen und zu ändern, um Innovationen zu ermöglichen und die damit verbundenen Investitionen zu fördern.
Mit der Vorlage des Regierungsentwurfs für ein Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende sowie dem Weißbuch liegen konkrete Vorschläge zur notwendigen Anpassung des rechtlichen Rahmens vor.
weitere Maßnahmen erforderlich
am Anfang
hohe Dringlichkeit
Die Einführung intelligenter Messsysteme im Bereich der Stromversorgung führt zu neuen Nutzungsmöglichkeiten, die dazu geeignet sind, die Kosten zu kompensieren. Können insbesondere die Smart Meter Gateways als universelle Kommunikationseinheit für mehrere Sparten, Abrechnungsmodelle oder Mehrwertdienste genutzt werden, ergeben sich weitere Einsparpotenziale und/oder ein zusätzlicher Kundennutzen. Deshalb kommt branchenübergreifenden Geschäftsmodellen, die die auszurollende Smart Meter Gateway-Infrastruktur nutzen, eine große Bedeutung zu.
Neben der Sicherung der Energieversorgung und Stabilisierung der Netzinfrastruktur sind die Nutzung von Synergien und die Entwicklung von Mehrwertdiensten enorm wichtig für die Akzeptanz des Smart Meter Rollouts in der Bevölkerung und für die Generierung von zusätzlichen Ertragspotenzialen für die Marktakteure. Um Mehrwertdienste entwickeln zu können, ist eine Mindestmenge von adressierbaren Nutzern und Anschlüssen erforderlich. Dieses Potenzial wird durch den Einbau intelligenter Messsysteme Zug um Zug geschaffen.
Mehrwertdienste in einer sicheren Umgebung sind z. B.: Energieeffizienzangebote, Home Automation, Optimierung des Energieeinkaufs, Gebäudemanagement, altersgerechtes Wohnen etc. Dafür ist insbesondere der hohe Sicherheitsstandard der eingebauten Kommunikationseinrichtungen – der Smart Meter Gateways – ein wesentlicher Erfolgsfaktor.
Synergien können insbesondere dadurch gehoben werden, dass möglichst viele Verbrauchstypen über das Smart Meter Gateway ausgelesen und übertragen werden. Entsprechende Geschäftsmodelle sollten gefördert werden. Wichtig ist die Ausweitung auf weitere Sparten wie z. B. Wärme und Wasser und die Offenheit für Mehrwertdienste. Hier setzt der Entwurf für das DigiEnerWG3 bzw. das MsbG4 die richtigen Signale. Diese Offenheit darf allerdings nicht durch den Messstellenbetreiber behindert werden.
weitere Maßnahmen erforderlich
am Anfang
Entscheidend für die Akzeptanz der Digitalisierung ist der unmittelbare Nutzen beim Verbraucher. Im hochregulierten Energiemarkt müssen dafür Politik und Industrie gemeinsam die richtigen Weichen stellen.
Ein Dialog zur Digitalisierung über die Energiewende-Plattformen im BMWi hinaus fand bislang nicht statt. Aufgrund der erheblichen Verzögerungen beim Rechtsrahmen für Intelligente Netze und Zähler wurden weder von der Wirtschaft noch von der Bundespolitik größere Informationskampagnen gestartet. Dabei ist ein früher Dialog mit den Nutzern im Bereich der regulierten Industrien essenziell. Hier sind jetzt beide Akteure gefordert. Zugleich sind die Kenntnisse über die Möglichkeiten einer digitalen Energiewende in der Bevölkerung noch gering.
Datenschutz und Datensicherheit sind neben schnell realisierbarem Nutzen der Schlüssel zur Akzeptanz. Gerade im Bereich der Energienetze sind hier grundsätzlich viele unterschiedliche Ausgestaltungen möglich. Es wurden umfangreiche Vorarbeiten geleistet, um etwa ein dem deutschen Datenschutzrecht entsprechendes Smart Metering zu ermöglichen.
Diese erheblichen Vorarbeiten für Privacy by design und Privacy by default müssen jetzt einfach und verständlich dargestellt werden. Mangels Kenntnis des genauen rechtlichen Rahmens ist dies bislang nur in Ansätzen möglich. Hier muss ein Schwerpunkt der Kommunikation liegen.
Für die Teilnahme an der Energiewende auf Verbrauchsseite fehlen heute noch vielerlei Prozesse und Bilanzierungsmethoden. Erst wenn diese von Industrie und Politik erarbeitet sind, können die Möglichkeiten der Partizipation durch Digitalisierung voll ausgeschöpft werden. Die Branche wartet hier auf den Startschuss durch die Politik bzw. die Bundesnetzagentur.
Im Bereich des optimierten Energienetzausbaus durch IKT sind im Grün- und im Weißbuch Strommarkt des BMWi erste interessante Ansätze enthalten, wie etwa der 3 %-Ansatz für geringeren Verteilnetzausbau. Diese scheinen jedoch für eine Bewertung noch nicht hinreichend ausspezifiziert. Grundsätzlich sollte stärker vermittelt werden, dass durch Digitalisierung und Interaktion erheblicher kostenintensiver Verteilnetzausbau vermieden werden kann.
Status und Fortschritt nach Zielbildern 2020
Die nachfolgenden Detailbetrachtungen zeigen die von der Projektgruppe „Intelligente Energienetze“ erarbeiteten Zielbilder für den in 2020 angestrebten Zustand des Energiesektors in den strategischen Ebenen. Nebenstehend wird der aktuelle Status und die Umsetzung ausgehend von diesem Zielbild bewertet. Detailbeschreibungen der Zielbilder/Zielbildbausteine finden Sie im Ergebnisbericht 20135
Ergebnisse der Projektgruppe Intelligente Energienetze
2015
Status und Fortschritt Intelligenter Energienetze in Deutschland
PDF-Dokument anzeigen
2015
Nutzen und Anwendungen Intelligenter Energienetze
PDF-Dokument anzeigen
Dossiers
Gesellschaftliche Ebene:
G-4 Fachkräftebedarf decken (PDF)
Business-Ebene:
B-3 Erhöhte Marktdynamik schaffen (PDF)
Prozess-Ebene:
P-1 Prozess-Framework für Smart Grid und Smart Market etablieren (PDF)
P-2 Koordinierte nationale und internationale Aktivitäten durchführen (PDF)
P-3 Effiziente Prozesse gewährleisten Netzstabilität (PDF)
2013
Ergebnisbericht 2013
Zielbilder Intelligenter Energienetze
PDF-Dokument anzeigen
Dossiers
Gesellschaftliche Ebene:
G-1 Partizipation fördern (PDF)
G-2 Energieautarkie gesellschaftsverträglich machen (PDF)
G-3 Optimierter Energienetzausbau unter effizienter Einbindung von IKT erhöht die gesellschaftliche Akzeptanz (PDF)
Business-Ebene:
B-1 Neue Geschäftsmodelle ermöglichen (PDF)
B-2 Neue Akteure und Rollen etablieren (PDF)
B-4 International integrierte Geschäftsmodelle statt Insellösungen anstreben (PDF)
Rechtliche / regulatorische Ebene:
R-1/2 Ordnungsrahmen für Plattformen und Marktrollen schaffen (PDF)
R-3 Datenschutz und -sicherheit gewährleisten (PDF)
R-4 Optimales Anreizsystem für Investitionen in IKT setzen (PDF)
Technische Ebene:
T-1 Branchenübergreifende IKT-Standards einführen (PDF)
T-2 Effizienten Datenaustausch gewährleisten (PDF)
T-3 Rollenmodell zur IKT-Nutzung abbilden (PDF)
T-4 Dezentralisierung der Energienetzführung mittels IKT unterstützen (PDF)
T-5 Versorgungszuverlässigkeit wahren (PDF)
- Entwurf eines Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende (link) ↩
- Ein Strommarkt für die Energiewende. Ergebnispapier des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (Weißbuch) (link) ↩
- Entwurf für ein Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende ↩
- Entwurf für ein Messstellenbetriebsgesetz ↩
- Ergebnisbericht 2013: Projektgruppe Intelligente Energienetze(link) ↩